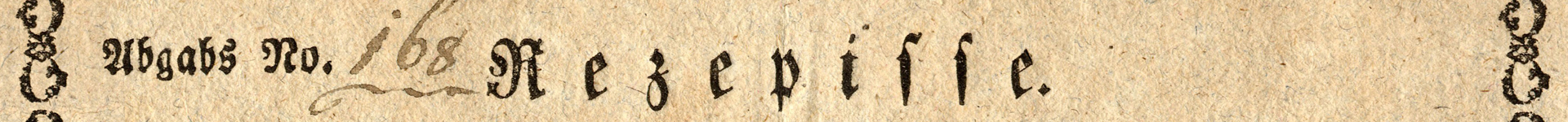Abgeschlossene Forschungsprojekte
Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert
Quellen zu Erbschaften deutscher Migranten im Königreich bieten einen einzigartigen Zugang zu den Lebenswelten der Auswanderer. Für die Quellenedition wurden Akten aus über 50 verschiedenen Archiven aus den Ländern Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Serbien und Ungarn herangezogen und publiziert. Sie informieren darüber, auf welchen Wegen die Migranten an ihr Geld gelangten, welche Abgaben sie zahlen mussten, wie sie von den habsburgischen Regierungsstellen in ihrem Bemühen unterstützt wurden, aber auch, wie manche Auswanderer versuchten, an ihr Erbe illegal zu gelangen. Die Dokumente geben Einblicke in die Investition des mitgebrachten und erhaltenen Vermögens und Erbes und in die Bemühungen der Verwandten und Ämter in den Herkunftsgebieten, das Erbe nach Ungarn zu transferieren. Zentrales Anliegen ist die Annäherung an den „homo migrans“: Die Quellen bieten einen Einblick in den Mikrokosmos der Akteure, aber auch in die von Krankheit und Tod geprägte demographische Krise der Anfangszeit. Insgesamt werden 138 Quellenkonvolute mit fast 700 Einzelquellen publiziert, darunter rund 130 Briefe von Auswanderern. Das Projekt wurde mit der Herausgabe der Quellenedition „Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert“ (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Bd. 19, Quellen und Forschungen, Bd. 3). Stuttgart 2015 abgeschlossen.
Normsetzung und Normverletzung. Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
Eine Annäherung an „alltägliche Lebenswelten“ von Untertanen stößt erfahrungsgemäß auf das Hindernis mangelnder Überlieferung von Selbstzeugnissen, Biographien, Tagebüchern und Briefen. Daher soll über den „Umweg“ der Normverletzung und Normvermittlung auch die „Norm“ selbst erforscht werden. Norm wird in diesem Zusammenhang sowohl soziologisch als „soziale Norm“ sowie jurisdiktionell als „Rechtsnorm“ verstanden. Lebenswelten sind nach einer Definition von Rudolf Vierhaus wahrgenommene Wirklichkeiten, in denen „soziale Gruppen und Individuen sich verhalten und durch ihr Denken und Handeln wiederum Wirklichkeit produzieren.“ Bei der „Normverletzung“ geht es einerseits um deviantes Verhalten von Individuen und Gruppen, andererseits um Delinquenz. Die Rekonstruktion von Lebenswelten im ethnokonfessionellen Mosaik des Königreichs Ungarn stellt ein besonders lohnenswertes Experimentierfeld dar. Das Projekt war Gegenstand der Jahrestagung des Instituts 2011. Die Ergebnisse flossen in einen Sammelband ein, der 2014 erschienen ist: „Normsetzung und Normverletzung. Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts“. Stuttgart 2014.
Agrarreformen und ethnodemographische Veränderungen. Südosteuropa vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart
Zentrales Ziel des Projektes war es, Zusammenhänge und Interdependenzen zwischen Agrarreformen und ethnodemographischen Veränderungen darzustellen, dies an Fallstudien zu rekonstruieren und die Schnittmengen zwischen beiden Phänomenen auszuloten. Dabei wird der Begriff „Agrarreform“ terminologisch sehr weit im Sinne von agrarischen Modernisierungsmaßnahmen gefasst, um die Veränderungsprozesse über einen Zeitraum von zwei Jahrhunderten verfolgen zu können. Die Jahrestagung des Instituts 2006 befasste sich mit dieser Thematik. Ausgangspunkt waren die Reformen des frühmodernen Staates, und das zeitliche Ende wird von den Umwälzungen des ländlichen Raumes in Südosteuropa nach 1989 und den bis heute wirkenden Kulturlandschaftsprozessen markiert. Im räumlichen Mittelpunkt steht der transleithanische Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie, wobei auch eine Kontextualisierung durch unterschiedliche Beobachtungsstandorte, Beobachtungs-instrumentarien, Perspektiven und Brennweiten auf die Prozesse sowie das Verfolgen der Entwicklung von Langzeitstrukturen (longue durée) angestrebt wird. Mit der Publikation des Sammelbandes „Agrarreformen und ethnodemographische Veränderungen. Südosteuropa vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart“ innerhalb der Schriftenreihe des Instituts (Sammelbände, Bd. 1) wurde das Projekt 2009 zu einem Abschluss gebracht.
Demographische Krise und Familien
Im Mittelpunkt stand die Erforschung demographischer Prozesse der Deutschen in Ungarn innerhalb ihres vielschichtigen ethnokonfessionellen Umfeldes. Wichtigste Quellen für das Projekt waren neben den Kirchenbüchern Gerichtsakten, administrative Akten, Selbstzeugnisse, Testamente, Eheverträge, Ehegerichtsakten u. a., mit denen eine Annäherung an die Thematik möglich ist. Das Projekt „Demographische Krise und Familien“ fand 2012 mit zwei größeren Beiträgen seinen Abschluss.
Erben und Sterben. Zur Rekonstruktion der Lebenswege von Auswanderern nach Ungarn aus dem Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen (mit Quellendokumentation). In: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte, Bd. 46 (2010), 123-182. Der Beitrag enthält einen rund 40seitigen Quellenanhang. Es handelt sich um Akten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, deren Entstehung auf ein bei der Auswanderung zurückgelassenes oder erhaltenes Erbe im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen zurückzuführen ist. Um das unter vormundschaftlicher Verwaltung stehende Erbe zu erhalten, wandten sich die Erben mit Briefen, Vollmachten und anderen Dokumenten an die Behörden von Hohenzollern. In Verbindung von Lebensdaten aus Kirchenbüchern lassen sich so Lebensabschnitte von Kolonisten rekonstruieren. Räumliche Schwerpunkte bilden das Auswanderungsgebiet Hohenzollern-Sigmaringen sowie das Zielgebiet der südlichen Batschka (heute Vojvodina, Serbien).
Ein weiterer Beitrag erschien Ende des Jahres 2013: Die Kinder der Kolonisten. Ansiedlung und demographische Krise im Königreich Ungarn. In: Migration nach Ost- und Südosteuropa im 18. und 19. Jahrhundert. Hg. v. Mathias Beer. München 2014, 167-217. Räumlicher Kristallisationspunkt ist das Fallbeispiel des Ortes Bukin (serb. heute Mladenovo, ung. Dunabökény) bei Neusatz (serb. Novi Sad, ung. Újvidék) in der Südbatschka (Vojvodina). Die mikrodemographischen Erhebungen wurden in quantitativ-demographische Auswertungen aus anderen Orten eingebettet. Dabei geht es nicht um die Ursachen der Krise im 18. und frühen 19. Jahrhundert, sondern um ihre Folgen für die Familien und Familienstrukturen sowie die dörflichen Lebenswelten in einer sich konstituierenden Gesellschaft.
Mord an der Donau: Leopold von Márffy und die deutschen Untertanen in Tscheb (1802-1812). Eine Mikrogeschichte der Gewalt.
Anlass für das Vorhaben ist der wissenschaftlich unerforschte, jahrelange Konflikt zwischen den Untertanen von Tscheb (serb. heute Čelarevo, ung. Dunacséb) bei Neusatz (serb. Novi Sad, ung. Újvidék) in der heutigen Vojvodina und dem Grundherrn Leopold Márffy. Dieser Konflikt endete vordergründig mit dem Mord an dem verhassten Grundherrn am 20. September 1812. Der Mord erfolgte nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Grundherrn und den von ihm angesiedelten deutschen Untertanen, die es nicht länger hinnahmen, „die Thyraney zu ertragen“. Erst 1814 wurden die Attentäter gefasst. Vom Komitat sollten sie standrechtlich zum Rädern verurteilt worden sein, worauf der Kaiser und König Franz nachdrücklich ein rechtmäßiges Verfahren anmahnte. Kern des Konflikts waren Urbarialstreitigkeiten, aber auch permanente Übergriffe und Rechtsverstöße des Grundherrn. An diesem Beispiel sollen mögliche Widerstandsformen der Untertanen im Ungarn des ausgehenden Ancien Régime und das breite Spektrum von Konfliktformen aufgezeigt werden, die sich in Rechtsstreiten, Beschwerden bis hin zur offenen Gewalt gegen einen als „Tyrannen“ bezeichneten Grundherrn äußerten. Der Prozess gibt aber auch einen Einblick in die Sozial- und Rechtsgeschichte im reformbedürftigen ständischen Rechtssystem Ungarns, das den Untertanen nur wenige Möglichkeiten eröffnete, ihr Recht einzuklagen. Bislang konnten Akten aus mehreren Archiven in Serbien und Ungarn recherchiert werden. Das Projekt fand seinen Abschluss durch die 2018 erfolgte Publikation in der Schriftenreihe „Südosteuropäische Arbeiten“ des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg.
Hatzfeld. Ordnungen im Wandel: Die Akteure: Eine historisch-demographische und historisch-anthropologische Annäherung
Im Rahmen des Institutsprojekts über Hatzfeld befasst sich der Beitrag zunächst mit den historisch-demographischen Parametern der ersten Jahrzehnte und der Analyse quantitativer demographischer Prozesse in Hatzfeld. Dabei geht es auch um die Folgen für das Leben und die Lebenswelten von einzelnen Personen und Familien. So hatte die initiale demographische Krise mit einer hohen Sterblichkeit der Ansiedler in der Forschung bislang kaum wahrgenommene Auswirkungen für die Familienstrukturen und -systeme. Als Folge der Migration sind zudem demographische Adaptionsstrategien festzustellen, etwa beim Heiratsalter. Enge Bezüge ergaben sich auch zu wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Prozessen. So stellt sich die Frage, welche demographischen „Spuren“ gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen hinterließen? Ebenso, ob sich Mechanismen demographischer „Autoregulation“ in einer vorindustriellen Gesellschaft zeigten? Daneben geht es um eine Annäherung an einzelne Akteure, die beispielhaft für Entwicklungen und Prozesse stehen. Zugrunde liegen Akten aus Archiven in Wien, Budapest, Neusatz (Novi Sad) sowie Temeswar (Timişoara).
Deutschsprachige Migranten in Ungarn und Russland: Zahlenfähigkeit und Humankapital (18. und 19. Jahrhundert)
Ausgangspunkt des Kooperationsprojektes mit Dr. Matthias Blum (Queen's University Belfast) und Dr. Dmytro Myeshkov (Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa, Lüneburg) ist das Phänomen des „age-heaping“ (Zahlenhäufung) bei Altersangaben. In Relation zu ihrem Alphabetisierungsgrad, Bildungsstand und ihrer sozioökonomischen Situation bestand bei befragten Personen die Tendenz, runde Zahlen anzugeben. Dies betrifft nicht nur die mit Null endenden Zahlen, sondern auch Angaben in Fünferschritten. Das Ausmaß des Rundungsindexes (gemessen als „Whipple Index“ oder „ABCC“) wiederum eröffnet die Möglichkeit einer breiteren historisch-demographischen und wirtschaftshistorischen Interpretation sowie Bewertung des „Humankapitals“ von Migranten sowie der Unterschiede zu anderen Bevölkerungsgruppen. Ebenso können Disparitäten zwischen den Geschlechtern und Konfessionen erörtert werden. Grundlage der Untersuchung sind einerseits die josephinischen Registrierungslisten der Ansiedler, andererseits Volkszählungen deutscher Ansiedler im Raum Molotschna (heute Molochansk, Ukraine), seit 1804 von mennonitischen Migranten besiedelt. 2017 erschien in der Zeitschrift „The Economic History Review“ ein Beitrag mit dem Titel „Age-heaping and numeracy: looking behind the curtain“.